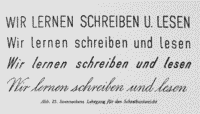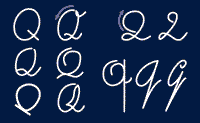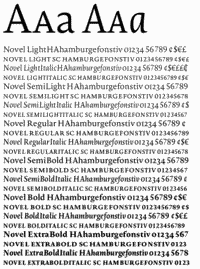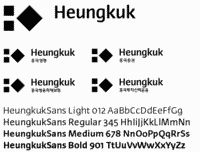Das war der Tag der Schrift 2008
Rektor Fritz Maurer freute sich als Hausherr der Berufsschule für
Gestaltung Zürich, unter den zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des 5. Tags der Schrift Hans Eduard Meier namentlich
begrüssen zu können. Richard Frick, der zusammen mit Erich
Halb durch den Tag führte, erinnerte einleitend an die mehrfachen
Jubiläen der Mediengewerkschaft comedia: zu 5 Jahren Tag der
Schrift kommen noch 20 Jahre Tag der Typografie, 75 Jahre
«Typografische Monatsblätter» und 150 Jahre Gewerkschaft.
Von der DIN-Schrift zur Round

Der Beitrag des in Deutschland arbeitenden Niederländers Albert-Jan
Pool führte durch die Geschichte mechanisierter Handschriften.
Am Anfang der Entwicklung, die schliesslich zur DIN-Schreibschrift
geführt hat, stand der Kampf des deutschen Büroartikel-Pioniers
Soennecken für eine vereinfachte Schreibschrift. Bereits
in den achtziger Jahren des vorletzten Jahrhunderts nahm er die
vor allem in deutschen Kanzleien verwendete Kurrentschrift
ebenso aufs Korn wie die gebrochenen Satzschriften. Soenneckens
Vorschläge aus dieser Zeit basieren folgerichtig auf der
lateinischen Schrift. Die Zeit war allerdings noch nicht reif dafür.
Unter den Vorschlägen des Schriftreformers Sütterlin für eine
neue Schulschrift wurde noch 1911 einer Variante der Vorzug
gegeben, die beträchtliche Konzessionen an die Kurrentschreibweise
macht. Für Soenneckens Ideen kam die Zeit dann am
Anfang des 20. Jahrhunderts mit der fortschreitenden technischen
Entwicklung. In der Wirtschaft entstand nun zunehmend Bedarf
an Rationalisierung und Normierung. Soenneckens Plattenfeder
mit einer kreisrunden Papierauflage, die in jeder Zugrichtung die
gleiche Strichstärke ergibt, war die Voraussetzung für eine leicht
normierbare Blockschrift. Sie liess sich so mit der Feder einfach
zu Papier bringen und bei Stanzungen oder Gravuren problemlos
umsetzen. Die daraus resultierende DIN 16 wird in der Zeit von
1919 bis 1975, ihrer Ablösung durch ISO 3096, fünfmal angepasst.
Die Verbreitung der DIN-Schrift brachte die grosse Zeit der
Schriftschablonen, die nun zu Hunderttausenden produziert wurden.
Heute, wo digitale Fonts und PC die Schablonen überflüssig
machen, sind aus der Tradition der DIN-Schrift mindestens die
Round-Schnitte übrig geblieben. Pool zeigte an mehreren Beispielen,
dass die Round, genau wie die «runden Ecken», mal
mehr, mal weniger in Mode ist, aber nie ganz verschwindet.
Vom Sinn und Unsinn der Schnürlischrift

Dass Sprachen Dialekte haben, ist bekannt. Dass man aber auch
bei Handschriften von Dialekten reden könnte, war am Tag der
Schrift von Florian Hardwig, Berlin, zu erfahren. Handschriften
sind demnach nur bedingt individuell. Sie sind stark geprägt durch
Schulmodelle und durch die Schriftgeschichte des jeweiligen Kulturkreises.
Hardwig war an einer Studie beteiligt, die Schulschrift-Vorlagen
12 verschiedener Länder untersuchte. Dabei haben sich
gewisse kulturell bedingte Charakteristika der Schreibweise
herausgestellt. Ein Merkmal ist auch: je häufiger ein Buchstabe
vorkommt, umso geringer ist die Varietät, während seltener verwendete
Buchstaben in der Regel eine reichere Formenvielfalt
aufweisen. Der Referent sieht aufgrund seiner Studien im Bruch
zwischen Schreib- und Druckschriften und der folglich fehlenden
Analogie der Buchstabenformen eine mögliche Ursache für
schlechte Handschriften. Gegenüber der «Schnürlischrift», die
Generationen von Schülern vermittelt wurde, hat er deshalb seine
Vorbehalte. Er trifft sich dabei mit Hans Eduard Meier, dem Entwerfer
der neuen Schulschrift, die eine Verbindung der Buchstaben
in der Handschrift nur noch dort vorsieht, wo sie im Interesse
des Schreibflusses Sinn macht. Schliesslich lüftete Hardwig noch
den Deckel über seinem Buchprojekt «Von Luftlinien, Flammenbögen
& Speedloops», in dem die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit
zusammengefasst sind.
-> florian.hardwig.com
Vom Wesen kyrillischer Schriften

Wohl kaum jemand wäre prädestinierter, die kyrillische Schrift
näherzubringen, als Jovica Veljovic. Aus Serbien stammend, hat
er für ITC und Adobe nicht nur namhafte Schriften geschaffen,
sondern sich auch einen Namen als Berater verschiedener Type
Foundries in Sachen kyrillische Schriften gemacht. Und zu verbessern
gab es da einiges. Bei der Umsetzung lateinischer
Schnitte ins kyrillische Alphabet wurde in der Vergangenheit oft
nicht die nötige Sorgfalt aufgebracht. Westlichen Schriftschaffenden
fehle meist das Gefühl für kyrillische Formen, erklärte Veljovic.
Aufgrund des byzantinischen Einflusses haben kyrillische
Schriften einerseits oft eine verspieltere Formensprache. Weil
aber die Horizontalen und Vertikalen dominieren und Ober- und
Unterlängen weniger häufig sind, wirkt kyrillischer Text anderseits
sehr viel statischer als man dies von lateinischer Schrift gewohnt
ist. Dies wiederspiegelt die von der Dogmatik geprägte Orthodoxie.
Und da letztere im Gegensatz zur katholischen Kirche nie
ein zentrales Oberhaupt hatte, haben sich auch die kyrillischen
Alphabete im Bereich der einzelnen orthodoxen Kirchen autonom
entwickelt. Bei Buchstabenformen im kyrillischen Alphabet, die in
der lateinischen Schrift nicht existieren, hat man sich in westlichen
Schriftschmieden oft mit einem Versatz aus Elementen
lateinischer Lettern begnügt. Das Resultat sind dann häufig
Schriftzeichen, die unproportional wirken, was der Referent an
einzelnen Beispielen eindrücklich vor Augen führte.
Type is boring. Is Type boring?

Christoph Dunst ist ein deutscher Grafik- und Schriftdesigner, der
an der Royal Academy of Art in Den Haag studiert hat und heute
in Amsterdam wirkt. Anhand der drei präsentierten Projekte zeigte
er, dass Typografie nicht langweilig sein muss.
Da waren für das koreanische Bankhaus Heunkuk und dessen
zahlreiche Tochterfirmen Hausschrift und Logos zu entwerfen.
Aus 3 Vorentwürfen kam die vom Kunden schliesslich favorisierte
Variante in die Detailausführung. Entstanden ist daraus ein Logo
mit äusserst klarer Formensprache, begleitet von einer serifenlosen
Linear-Antiqua, der HeungkukSans. Obwohl die Schrift mit
ihrer betonten Mittellänge kompakt wirkt, bildet sie einen gewissen
Kontrast zur Strenge des Logos. Christoph Dunst hat die
HeungkukSans in den Schnitten Light, Regular, Medium und Bold
gezeichnet. Mit Antenatal (=unvollendet) zeigte der Schriftdesigner
eine nicht kommerzielle Fontstudie, in der er Form und Kontraste
ausgereizt hat. Daraus resultierte ein sehr kräftiger Buchschnitt.
Die Novel Serif, das dritte Projekt, basiert auf einer
Renaissance-Antiqua, die einst in der Offizin von Christoffel Plantijn
in Antwerpen verwendet wurde. Dunst hat in der Digitalisierungsphase
die leichteren Schnitte aus dem kräftigen Buchschnitt
heraus entwickelt. Die nur schwach geneigte Kursive der
Familie läuft ausnehmend schmal und wirkt so sehr elegant. Bei
den Kapitälchen, die für alle Stärken (Light, SemiLight, Regular,
SemiBold, Bold und ExtraBold) vorhanden sind, wurde der Rhythmus
bewusst verändert, um ihnen etwas von der statischen Wirkung
zu nehmen. Das ist beispielhaft für die grosse Sorgfalt, mit
welcher der Referent diese Schriftfamilie entworfen hat. Die Auseinandersetzung
mit jedem einzelnen Buchstaben einer Schrift,
bevor es an die Digitalisierung geht, gehört zu seinen Prinzipien,
denn: «Wer nur digital an die Sache herangeht, arbeitet von
Anfang an auf Produktion. Und das wäre dann allerdings langweilig.»
-> www.christophdunst.com
Sprühender Ideenreichtum

Jeroen Klaver, ein niederländischer Illustrator kreiert für seine
Grafikarbeiten meist gleich die passende Schrift, um seine «Projekte
so vielseitig wie möglich zu halten». Die Schriften Klavers
sind denn in ihrem Ausdruck auch so vielfältig wie der Ideenreichtum
in seinem grafischen Schaffen grenzenlos zu sein scheint. Da
ist im ganzen Spektrum, das vom respektlos frechen Flyer über
Buchcovers, Logos, Flashgestaltung bis zu Magazinen und
Comics reicht, trotz unglaublicher Produktivität kein Hauch von
«08/15» zu erkennen. So liess der Referent denn ein wahres
Ideenfeuerwerk über die Teilnehmenden ergehen, das sich zu
einem Schlussbouquet eines weiteren erfolgreichen Tages der
Schrift auswuchs. Wer das ebenfalls (oder nochmals) erleben
möchte, ruft am besten www.shamrocking.com auf...