|
|

|
|
|
|
Ein Tag der Typografie in Bern: «Schrift im Raum»
Ein Thema mit zahlreichen Aspekten «Schrift im Raum» – so das Thema des diesjährigen Tags der Typografie – hat viele Aspekte. Die Referentinnen und Referenten gingen an der comedia-Veranstaltung vom 26. November das Thema von ganz unterschiedlichen Standorten her an. Die über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen dabei auf ihre Rechnung. Die 12. Ausgabe dieser renommierten comedia-Veranstaltung steht ihren erfolgreichen Vorgängerinnen nicht nach. Mit einer gekonnten Präsentation stimmten Agnès Laube, Inhaberin eines Salons für Konstruktionen von Wirklichkeit, und der Architekt Othmar Schäublin ins Tagungsthema ein, wobei sie den dreidimensionalen, urbanen Raum im Auge hatten. Sie stellten ein städtebauliches Credo an den Anfang, wonach es falsch sei, eine Stadt beherrschen zu wollen. Sie zu unterstützen sei alles, was man für sie tun könne. Gilt das auch für die Beschilderung und Beschriftung, die in unserer von Informationsfülle und Wettbewerb geprägten Gesellschaft immer mehr das Bild unserer Siedlungen – zumal der städtischen – prägt? Diese Frage könnte etwa dort eine Rolle spielen, wo die verschiedenen Interessen aufeinanderprallen, das Interesse der Auftraggeber einerseits, die in der Öffentlichkeit mit Schrift etwas mitteilen möchten, und das Interesse der Öffentlichkeit anderseits, die mit Bewilligungsverfahren bestrebt ist, reglementierend einzuwirken.  Schrift im öffentlichen Raum – keine Frage der Ästhetik Aber auch zwischen Bauherrschaft und Architekt gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Für Architekten stellen Wünsche nach Beschriftung an ihrem Bau meist Störfaktoren dar. Wie sehr wir aber auf die Beschriftung im öffentlichen Raum angewiesen sind, zeigt sich an unserer Hilflosigkeit, wenn wir uns in Kulturräumen aufhalten, in deren Siedlungen andere, uns nicht bekannte Informationscodes benutzt werden. So bleibe uns nichts anderes übrig, als mit der Beschriftung im öffentlichen Raum zu leben und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und eines müsse man sich bei Schrift im öffentlichen Raum im Klaren sein: ob etwas als schön empfunden wird, hat hier keinen Zusammenhang mit Ästhetik. Seit den Anfängen der Typografie ist bei der Buchgestaltung der starre Satzspiegel die Norm. Diese Fessel der «Gutenberg-Galaxis» zu sprengen, hat sich der Buchgestalter und Kieler Hochschullehrer Klaus Detjen aufgemacht. Schrift und Typografie sollen damit wieder eins werden mit der Sprache, deren Rhythmus und Bewegung Ausdruck geben. Detjen knüpft dabei an einem Experiment des Franzosen Mallarmé an, der Ende des 19. Jahrhunderts mit seinem Werk «Coup des dés» durch die Verwendung von Weissräumen und seitenspringenden Typen mit der Linearität gebrochen hatte und der Typografie so eine poetische Struktur gab und so schrittmachend für die experimentelle Typografie des 20. Jahrhunderts war.  Eine Doppelseite aus Jelinek, «Wolken.Heim» Mit seiner Typographischen Bibliothek im Steidl-Verlag will Detjen dem Medium Schrift und Typografie ein neues, wirkungsvolles Forum bieten, um Buchliebhaber und Literaturinteressierte für ungewöhnliche und zukunftweisende Gestaltungsformen einzunehmen. 3 Werke dieses Anspruchs sind bisher entstanden. Neben einer Neuumsetzung von Mallarmés «Coup des dés» ist Elfriede Jelineks «Wolken.Heim» im Steidl Verlag erschienen. Diesem Buch liegt eine CD-ROM mit der durch die Schauspielerin Barbara Nüsse gelesenen Fassung bei. Zusammen mit der Typografie ergibt sich so eine intensive audio-visuelle Verstärkung des geschriebenen Wortes. Mit Michel Leiris' «Alphabet» hat Detjen ein weiteres Werk in lautmalende Typografie umgesetzt. Die Zerstückelung der Gedanken findet sich in wechselnden Einzügen wieder. 3 zarte Hintergrundfarbtöne, die in immer wechselnden Kombinationen durch das Buch begleiten, haben wiederum einen Bezug zum Inhalt. Ein weiteres Detail der sorgfältigen Buchgestaltung: Schriftpägung macht den Umschlag tastbar. Und nur konsequent ist, wenn Detjen auch durch das Weglassen des Schmutztitels mit Jahrhunderte alten Konventionen bricht und den Leser und die Leserin über die spiegelverkehrt zur Prägung bedruckte Umschlaginnenseite direkt zum Inhalt führt. Der Anarchie im Internet, die – im Unterschied zum stigmatisierten politischen Anarchiebegriff – in der Öffentlichkeit im allgemeinen eher auf Wohlwollen stösst, kann die Berliner Designerin Veruschka Götz nicht nur Positives abgewinnen. Die Anhäufung von belanglosen Informationen lässt die Freiheit in Unfreiheit umschlagen; dem Informationsempänger wird es immer schwerer gemacht, sich in den uneinheitlichen Codes zurechtzufinden. Götz plädierte daher für eine neue Gestaltungsdidaktik, die auf einer sinnvollen Kommunikation zwischen Informationssender und -empänger basiert. Dazu gehören sowohl eine webgerechte, redundante Textredaktion als auch Navigationsmittel, die dem Benutzer und der Benutzerin ermöglichen, sich im Informations- und Datenraum zu bewegen, ohne die Orientierung zu verlieren. Vieles erinnere sie im Webdesign an die Anfänge des Automobilbaus, erklärte die Referentin. Die motorgetriebenen Fahrzeuge benötigten zwar keine vorgespannten Pferde mehr, waren aber noch wie Kutschen gebaut. Im Webdesign sieht sie eine Analogie. Die Webgestalter haben sich zum grossen Teil noch nicht vom Printmedium emanzipiert und wollen offenbar nicht zur Kenntnis nehmen, dass Typografie und Farbverwendung am Bildschirm anderen Gesetzen unterliegt als auf dem Papier. Obwohl dies ergonomisch wie ökonomisch unsinnig ist, werden Webseiten überwiegend mit weissem Hintergrund versehen. Benutzerfreundlicher ist jedoch ein dunkler Hintergrund mit heller, jedoch nicht überstrahlender Schrift. Als Webdesignerin und Webdesigner gelte es, die Schwächen des Comupters zu berücksichtigen und seine Stärken zu nutzen. Äusserst kurzweilig war es, den Schilderungen des niederländischen Schriftkünstlers und Lehrstuhlinhabers Gerard Unger zu folgen, welcher der Stadt Rom für das Heilige Jahr ein neues Leitsystem und eine passende Schrift zu entwickeln hatte. Dies in einer Stadt mit einer 2000jährigen Tradition öffentlicher Beschriftungen und an der Geburtsstätte epochemachender Schriften realisieren zu dürfen, und dazu noch in äusserst kürzester Zeit, betrachtete er als grosse Herausforderung. 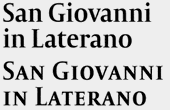 Ungers Capitolium in der Schilderversion. Aus Gründen der Leserlichkeit und der Platzökonomie wurde die Variante mit Gemeinen ausgeführt Unger trachtete danach, an der römischen Schrifttradition anzuknüpfen, aber sich nicht auf ein einfaches Revival zu beschränken. Er liess sich schliesslich von der um 1570 von Cresci entworfenen Lettera antica tonda inspirieren. Daraus ist mit der Capitolium nach mehrmaliger Überarbeitung eine Schrift entstanden, die unterdessen ihre praktische Bewährungsprobe bestanden hat. Eine Schrift mit einem klassisch-vornehmen Ausdruck, die mit ihren kurzen Ober- und Unterlängen jedoch sehr modern wirkt. Eine zuerst in Erwägung gezogene serifenlose Variante hatte nicht die Gnade der Auftraggeber gefunden. Obwohl: Unger hätte auch in diesem Falle auf eine altrömische Tradition verweisen können, an einem Tempel hatte er eine serifenlose, konstruktivistische Inschrift aus vorkaiserlicher Zeit ausgemacht. Unger musste von Anfang an darauf achten, dass die Schrift sowohl auf Offsetpapier wie auf Papier schlechterer Qualität, mit Laserdruck wie mit Inkjet optimal einsetzbar ist. Für dieses Einsatzgebiet stehen vier Schnitte der Familie (light, regular, regular italic, bold) zur Verfügung. In den unbekannten Raum der «Sinnlichkeit der neuen Medien» liess Claudius Lazzeroni, Professor für Interfacedsign an der Universität GH Essen, die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer vorstossen. Anhand von Umsetzungsexperimenten zeigte er, in welche Richtung denkbare Entwicklungen gehen könnten. Bei den Beispielen wird vor allem mit Klang und Farbe gespielt. Oder bei Userfehlern wird, statt dass trockene Dialogboxen erscheinen, der Mauspfeil mit Kommentar an den Ausgangspunkt zurckspediert. Im Prinzip stehe man noch ganz am Anfang, erklärte Lazzeroni. Noch ziemlich im Unklaren sei man sich darüber, wie etwa Zeit spürbar gemacht oder der Tastsinn mobilisiert werden kann. Aber die zunehmende Bedeutung der Sensorik werde auch neue Möglichkeiten eröffnen. Bei der Suche nach der Sinnlichkeit der neuen Medien gehe es nicht zuletzt um die Inszenierung des Zwischenraums. Zwischenraum sei einerseits zwar auch Inhalt, habe anderseits mit Grenzen zu tun. Damit müsse man lernen umzugehen. Eine grosse Rolle werde die Synchronizität und die Verknüpfung verschiedener Medien spielen. «In Zukunft wird es mehr Regisseure als Designer brauchen», schätzt Lazzeroni. Parallelität und Dramaturgie würden im Mediendesign eine ganz neue Qualität erhalten. Er empfahl jedem Medienschaffenden dringend, sich mit dem Thema «Sinnlichkeit der neuen Medien» ernsthaft auseinander zu setzen. Dazu würde er sich mehr solche Begegnungen wünschen, wie sie dieser Tag der Typografie ermöglicht habe. |
In der Ausgabe 6/2000 der
«Typografischen Monatsblätter»
können die meisten der am Tag der Typografie gehaltenen Referate nachgelesen werden.

|
|
|
|
Bildbericht 
|